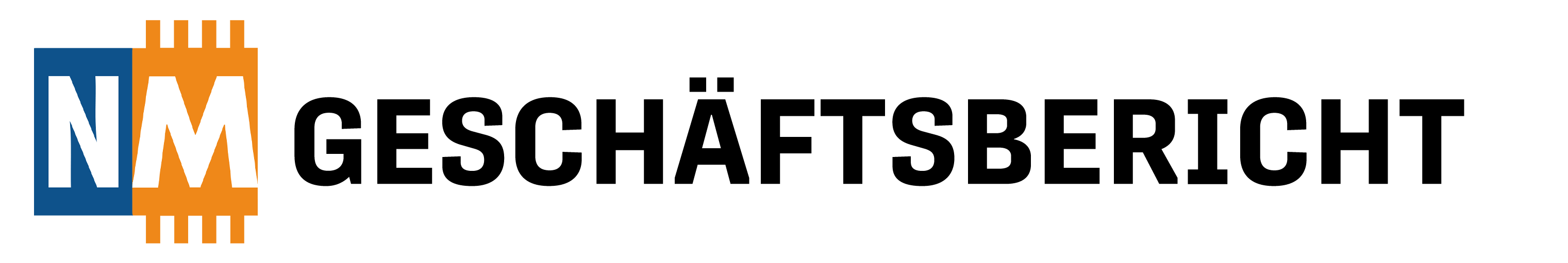Arbeitsrecht
Zeitraum: Juli 2023 bis Juni 2025
1. Einleitung

Der Zeitraum von Juli 2023 bis Juni 2025 war geprägt von bedeutenden Entwicklungen im deutschen Arbeitsrecht. Zahlreiche höchstrichterliche Urteile des Bundesarbeitsgerichts (BAG) und relevante Gesetzesreformen haben die arbeitsrechtliche Praxis nachhaltig beeinflusst. Im Mittelpunkt standen dabei unter anderem die Arbeitszeiterfassung, das Homeoffice, der Kündigungsschutz sowie neue Vorgaben zu Gleichstellung und Fachkräfteeinwanderung. Dieser Bericht fasst die zentralen arbeitsrechtlichen Neuerungen für die Unternehmenspraxis zusammen.
2. Wichtige Urteile des Bundesarbeitsgerichts
2.1 Arbeitszeiterfassung – Pflicht zur Einführung eines Systems
Auf Grundlage eines EuGH-Urteils von 2019 stellte das BAG (Urteil v. 13.09.2022, 1 ABR 22/21, bestätigt durch Folgeurteile 2023/24) klar, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, ein System zur vollständigen Erfassung der Arbeitszeit einzuführen. In mehreren Folgeentscheidungen im Jahr 2023 wurde die Pflicht konkretisiert:
- Auch ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung ergibt sich die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung aus § 3 ArbSchG.
- Vertrauensarbeitszeit bleibt grundsätzlich möglich, erfordert aber ein System, das zumindest Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit dokumentiert.
- Die Delegation an Arbeitnehmer ist zulässig, die Verantwortung verbleibt jedoch beim Arbeitgeber.
Diese Urteile haben erhebliche Auswirkungen auf Unternehmen – insbesondere im Hinblick auf Compliance und Datenschutz. Inwieweit der Gesetzgeber nun Änderungen im ArbZG noch in 2025 oder zu Beginn 2026 umsetzen wird bleibt abzuwarten.
2.2 Kündigung wegen Arbeitsverweigerung im Homeoffice
Das BAG (Urteil v. 29.02.2024, 2 AZR 25/23) entschied erstmals zu einer fristlosen Kündigung wegen beharrlicher Arbeitsverweigerung im Homeoffice. Ein Arbeitnehmer hatte sich über Wochen nicht eingeloggt und auf Anfragen nicht reagiert. Das Gericht bestätigte die Kündigung und stellte klar, dass auch im Homeoffice arbeitsvertragliche Pflichten in vollem Umfang gelten. Dieses Urteil stärkt die Arbeitgeberseite bei der Kontrolle hybrider Arbeitsmodelle.
2.3 Altersdiskriminierung
Das BAG (Urteil v. 25.04.2024, 8 AZR 140/23) stellte fest, dass die Einstellung eines älteren Bewerbers wegen Überschreitens der Regelaltersgrenze abgelehnt werden kann, falls ein jüngerer, qualifizierter Bewerber vorhanden ist. Im Streitfall hatte sich ein Lehrer, der sich nach Erreichen der Regelaltersgrenze im Altersruhestand befand, auf eine Vertretungsstelle als angestellte Lehrkraft beworben. Das beklagte Bundesland besetzte die Stelle mit dem jüngeren Bewerber, worauf der älterer Bewerber eine Entschädigung wegen Altersdiskriminierung forderte. Der 8. Senat hat zwar eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Alters angenommen, sie aber aufgrund eines legitimen Ziels für gerechtfertigt eingestuft. Dieses liegt in der besseren Beschäftigungsverteilung zwischen den Generationen mittels einer Förderung des Zugangs jüngerer Menschen zur Beschäftigung
2.4 Rückzahlung von Fortbildungskosten
In diesem Urteil stärkte das BAG (Urteil v. 23.01.2024, 9 AZR 115/23) die Rechte der Arbeitnehmer: Im vorliegenden Fall hat die Rückzahlungsverpflichtung gegen § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB verstoßen. Einzelvertragliche Vereinbarungen, nach denen sich ein Arbeitnehmer an den Kosten einer vom Arbeitgeber finanzierten Schulung zu beteiligen hat, wenn er vor Ablauf bestimmter Fristen aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet, sind zwar grundsätzlich zulässig. Im vorliegenden Fall war die Klausel aber so formuliert, dass der Arbeitnehmer die Schulungskosten gestaffelt zurückerstatten musste, wenn sein Arbeitsverhältnis innerhalb von fünf Jahren ab Beschäftigungsbeginn beendet wird und die Beendigung nicht aus Gründen der Freisetzung von Arbeitskräften erfolgt. Andere Gründe nannte die Klausel nicht. Verpflichtet eine Klausel den Arbeitnehmer aber auch dann zur Erstattung von Schulungskosten, wenn der Grund für die Eigenkündigung des Arbeitnehmers aus der Sphäre des Arbeitgebers stammt, benachteiligt sie den Arbeitnehmer entgegen dem Gebot von Treu und Glauben unangemessen.
2.5 Befristung ohne Sachgrund bei Vorbeschäftigung
Das BAG (Urteil v. 15.12.2021, 7 AZR 530/20) präzisierte erneut die Grenzen für sachgrundlose Befristungen bei zuvor beschäftigten Arbeitnehmern (§ 14 Abs. 2 TzBfG).
Im Urteil stellte das Gericht klar, dass selbst eine lang zurückliegende Beschäftigung – in diesem Fall vor über 12 Jahren – einer sachgrundlosen Befristung nicht grundsätzlich entgegensteht, sofern kein enger inhaltlicher Zusammenhang zum neuen Arbeitsverhältnis besteht. Die Entscheidung stärkt die Flexibilität von Unternehmen, wirft aber erneut Fragen zur Rechtsunsicherheit in der Befristungspraxis auf.
2.6 Verjährung von Urlaubsansprüchen
Das BAG (Urteil v. 31.01.2023, 9 AZR 456/20) urteilte zur Frage, wann Urlaubsansprüche verjähren, insbesondere bei fehlender Hinweis- und Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers.Nach diesem Urteil verjähren nicht genommene Urlaubsansprüche nur dann, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zuvor nachweislich und individuell auf seinen Urlaubsanspruch hingewiesen hat. Andernfalls beginnt die dreijährige Verjährungsfrist gar nicht erst zu laufen.Dieses Urteil hat erhebliche praktische Relevanz, da es rückwirkend finanzielle Risiken für Unternehmen birgt – insbesondere bei langjährigen Arbeitsverhältnissen.
2.7 Mitbestimmung bei KI-Systemen
Erstmals hat ein Gericht (Arbeitsgericht Hamburg, Urteil vom 16.01.2024, 24 BVGa 1/24) zur Mitbestimmungspflicht des Betriebsrats bei dem Einsatz künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz entschieden. Im konkreten Fall ging es darum, dass der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern die (freiwillige) Nutzung von ChatGPT am Arbeitsplatz gestattet hat, soweit diese ihre privaten Accounts benutzen. Der Betriebsrat berief sich in seinem Antrag darauf, dass die Erlaubnis zur Nutzung von ChatGPT seine Rechte auf Mitbestimmung grob verletzen würde. Das Arbeitsgericht Hamburg sah keine Verstöße gegen die in § 87 BetrVG festgehaltenen Mitbestimmungsrechte, denn die KI-Anwendung sei von den Mitarbeitern freiwillig und ausschließlich über den Browser genutzt worden. Deswegen sah das Arbeitsgericht auch keine Gefahr eines möglicherweise entstehenden Überwachungsdrucks, da der Arbeitgeber keinen Zugriff auf die vom KI-Betreiber gesammelten Daten habe
3. Neue gesetzliche Regelungen im Arbeitsrecht
3.1 Reform des Arbeitszeitgesetzes (Entwurf 2024, Inkrafttreten voraussichtlich Q4/2025)
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat einen Gesetzesentwurf zur Reform des Arbeitszeitgesetzes vorgelegt. Wesentliche Punkte:
- Einführung einer digitalen Arbeitszeiterfassungspflicht mit täglichen Aufzeichnungspflichten.
- Ausnahmen für Kleinbetriebe und leitende Angestellte.
- Möglichkeit zur tariflichen Abweichung hinsichtlich der täglichen Höchstarbeitszeit. Diese Regelungen sollen voraussichtlich Ende 2025 in Kraft treten und gelten als Reaktion auf die Rechtsprechung des EuGH und des BAG.
3.2 Fachkräfteeinwanderungsgesetz (Stufenweise Inkrafttreten ab November 2023 bis Juni 2024)
Mit dem novellierten Fachkräfteeinwanderungsgesetz wird der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt für Drittstaatsangehörige erleichtert. Wesentliche Neuerungen:
- Einführung der „Chancenkarte“ mit Punktesystem für die Arbeitssuche.
- Anerkennung beruflicher Qualifikationen vereinfacht.
- Möglichkeit zur Beschäftigung ohne formale Gleichwertigkeit bei mindestens zwei Jahren Berufserfahrung.
Dieses Gesetz zielt auf die Bekämpfung des Fachkräftemangels und hat direkte Auswirkungen auf HR-Abteilungen im Recruiting-Prozess.
3.3 Hinweisgeberschutzgesetz (Inkrafttreten: 02.07.2023)
Das Gesetz schützt Beschäftigte, die auf Missstände im Unternehmen hinweisen. Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden müssen ein internes Meldesystem einrichten. Pflichten für Arbeitgeber:
- Einrichtung vertraulicher Meldekanäle.
- Verbot von Repressalien gegenüber Hinweisgebern.
- Dokumentationspflichten.
Unternehmen mussten bis spätestens Dezember 2023 entsprechende Prozesse etablieren.
3.4 Gesetz zur Förderung von Mobilem Arbeiten (in Planung, Stand: Juni 2025)
Obwohl noch nicht verabschiedet, liegt ein Referentenentwurf vor, der das Recht auf mobile Arbeit gesetzlich absichern soll. Kernelemente:
- Ein Inkrafttreten wird frühestens 2026 erwartet, dennoch hat der Entwurf bereits die betriebliche Praxis beeinflusst.
- Anspruch auf mobiles Arbeiten an mindestens 12 Tagen pro Quartal.
- Pflicht des Arbeitgebers zur Ablehnung nur mit nachvollziehbarer Begründung.
4. Ausblick und Handlungsempfehlungen
Die Jahre 2023 bis 2025 waren geprägt von einer fortschreitenden Digitalisierung des Arbeitsrechts und einer stärkeren Ausrichtung auf Arbeitnehmerschutz in modernen Arbeitsformen. Für Unternehmen ergeben sich daraus klare Aufgaben:
- Implementierung rechtssicherer Zeiterfassungssysteme
- Anpassung arbeitsvertraglicher Klauseln
- Überprüfung von Stellenausschreibungen und Fortbildungsvereinbarungen
- Einrichtung und Pflege von Hinweisgebersystemen
- Vorbereitung auf mögliche gesetzliche Ansprüche auf mobile Arbeit
Ein professionelles Personalmanagement ist gefordert, die neuen Regelungen in Prozesse zu überführen und Mitarbeitende sowie Führungskräfte entsprechend zu schulen.
5. Fazit
Die arbeitsrechtliche Landschaft in Deutschland befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Die wichtigsten Impulse kamen durch höchstrichterliche Urteile, gesetzgeberische Maßnahmen zur Digitalisierung sowie demografische Entwicklungen. Unternehmen sind gut beraten, die arbeitsrechtlichen Entwicklungen eng zu begleiten und in ihre strategischen Überlegungen einfließen zu lassen.