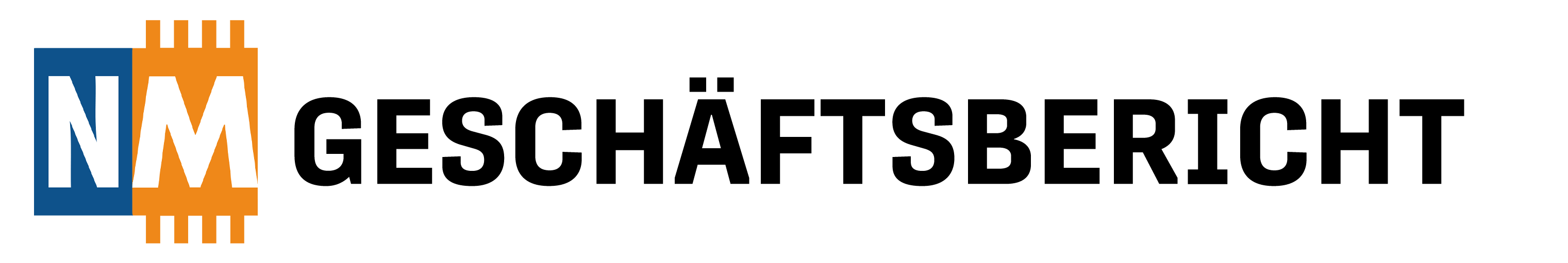Pressekonferenzen

Foto: Michael Wallmüller

Foto: Michael Wallmüller
2023:
Mittelständische Unternehmen in Niedersachsen haben zunehmend Schwierigkeiten, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Das zeigt eine Umfrage unter 620 mittelständischen Unternehmen, die von 14 Arbeitgeberverbänden und der Stiftung NiedersachsenMetall durchgeführt wurde.
Trotz hoher Ausbildungsbereitschaft mittelständischer Unternehmen in Niedersachsen bleiben viele Ausbildungsplätze unbesetzt. Laut einer Umfrage von Arbeitgeberverbänden bieten 95 Prozent der Betriebe ausreichend Plätze an, doch auf 30.000 offene Stellen kommen nur 21.000 Bewerber. „Die Unternehmen sind sehr engagiert bei der Nachwuchsgewinnung“, sagt Dr. Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände.
Das eigentliche Problem liegt laut Schmidt in der sinkenden Qualifikation: Drei Viertel der Betriebe kritisieren mangelnde Kompetenzen – besonders in Mathematik und Naturwissenschaften. Corona habe Bildungsdefizite verschärft und die Berufsorientierung nahezu zum Erliegen gebracht. „Wir schlittern sehenden Auges in eine langanhaltende Krise“, warnt Schmidt.
Auch Olaf Brandes von der Stiftung NiedersachsenMetall sieht die Ursachen nicht in zu wenig Plätzen, sondern in der Bewerberqualität. Zwei Drittel der Unternehmen verlangen kein Abitur, 60 Prozent akzeptieren auch einen Hauptschulabschluss. „Abiturienten nehmen niemandem den Platz weg“, stellt Brandes klar. Bei Sprachkenntnissen zeigen sich viele Betriebe flexibel. Wichtig sei nur, dass Auszubildende im Betrieb und in der Berufsschule mitkommen. Schmidt fordert praxisnahen Unterricht, bessere Ausstattung und Mentorenprogramme für lernschwache Jugendliche.
Floyd Janning von der Sonnentaler GmbH betont die Bedeutung praktischer Erfahrung und kritisiert die Zersplitterung der Jobbörsen. „Wir brauchen zentrale, staatliche Plattformen“, so Janning. Zudem müsse das Handwerk attraktiver gemacht werden.
„Viele wandern in Studium oder Ausland ab, obwohl die Chancen im Handwerk stark gestiegen sind.“
Fazit: Ausbildungsplätze sind da – aber es fehlen qualifizierte, vorbereitete und informierte Jugendliche. Die Corona-Folgen verschärfen die Lage weiter. Jetzt ist entschlossenes Handeln gefragt.
2024:

Foto: Michael Wallmüller
Niedersachsens Industrie fällt im Bundesvergleich zurück – IW-Studie warnt vor schleichender Deindustrialisierung.
Niedersachsen verliert wirtschaftlich an Boden. Laut einer im Sommer 2024 durchgeführten Studie von IW Consult im Auftrag von NiedersachsenMetall stagniert das reale BIP pro Kopf seit 2016 – während andere westdeutsche Flächenländer weiter wachsen. „Unser Bundesland hat ein echtes Wachstumsproblem“, warnt Dr. Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer von NiedersachsenMetall. Besonders alarmierend: Die Industrie schwächelt, Investitionen brechen ein, Arbeitslosigkeit steigt.
Als Hauptursache sieht die Studie schlechte Standortbedingungen. Die Investitionen der Industrie sind seit 2019 rückläufig, während viele Unternehmen lieber im Ausland expandieren. Hohe Energiekosten, hohe Steuern und überbordende Bürokratie bremsen die Wirtschaft. „Rückläufige Investitionen sind immer Vorboten eines sinkenden Wohlstands“, so Schmidt. Die Automobilindustrie, Schlüsselbranche in Niedersachsen, steht besonders unter Druck. Sie stellt 22 Prozent aller Industriearbeitsplätze im Land – deutlich mehr als im Bundesschnitt. Doch Absatzprobleme und politisch getriebene Investitionen in die E-Mobilität führen zu Überkapazitäten. „Die Fixkosten gehen bei vielen Unternehmen schlicht durch die Decke“, warnt Schmidt. Eine Stabilisierung sei nur möglich, wenn Umsätze im Verbrennergeschäft gesichert und Investitionen in neue Technologien ermöglicht würden.
Um dem Trend entgegenzuwirken, fordert NiedersachsenMetall fünf politische Maßnahmen: bessere Standortbedingungen, wettbewerbsfähige Energiekosten, aktive Fachkräftesicherung, vereinfachte Forschungsförderung und mehr Technologieoffenheit statt ideologischer Regulierung.
„Es geht nicht um Glaubensfragen, sondern um den bestmöglichen Weg zur Dekarbonisierung“
sagt Schmidt mit Blick auf das Verbrennerverbot ab 2035 und ergänzt:
Ohne spürbare politische Gegenmaßnahmen drohe Niedersachsen, wirtschaftlich weiter abgehängt zu werden. Die Industrie brauche Investitionsanreize, Planungssicherheit – und eine realitätsnahe Industriepolitik.
2025:
Niedersachsens Industrie in tiefer Krise – bis 2026 droht der Verlust von 50.000 Arbeitsplätzen.
Die niedersächsische Industrie steckt weiter in der Rezession – und das wohl auch 2025. Laut einer Konjunkturumfrage von NiedersachsenMetall droht bis Mitte 2026 der Abbau von mindestens 50.000 Industriearbeitsplätzen, besonders in der Autoindustrie. „Teile unserer Industrie befinden sich im freien Fall“, warnt Hauptgeschäftsführer Dr. Volker Schmidt. Der massive Stellenabbau sei Folge jahrelanger Belastungen – von Corona über den Ukraine-Krieg bis zu steigenden Energie- und Lohnkosten sowie einer verunsichernden Wirtschaftspolitik. Besonders dramatisch zeigt sich die Entwicklung im zweiten Halbjahr 2024: Die Auftragslage ist vielerorts eingebrochen, 45 Prozent der Unternehmen planen Stellenabbau. In der Autoindustrie rechnen 61 Prozent mit Produktionskürzungen – mit Folgen für den gesamten Standort.
„56 Prozent der FuE-Ausgaben in Niedersachsen kommen aus dem Automotive-Bereich. Bricht er weg, steht auch unsere Innovationskraft auf dem Spiel“
so Dr. Volker Schmidt.
Zudem fließen Investitionen zunehmend ins Ausland. Zwei Drittel der neuen Investitionen erfolgen nicht mehr in Niedersachsen oder Deutschland – wegen besserer Standortbedingungen. „Für den Kapitalstock in Niedersachsen ist das katastrophal“, sagt Schmidt. Um die Industrie zu stabilisieren, fordert NiedersachsenMetall kurzfristig einen erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld, mittelfristig eine Wirtschaftswende: wettbewerbsfähige Energiepreise, niedrigere Unternehmenssteuern, weniger Bürokratie – und mehr Technologieoffenheit. Schmidt kritisiert die einseitige Fokussierung auf E-Mobilität: „Sie wirkt derzeit wie ein Brandbeschleuniger für die Verlagerung von Arbeitsplätzen. E-Mobilität darf kein Selbstzweck sein – auch Hybrid, E-Fuels und Wasserstoff müssen eine Rolle spielen.“