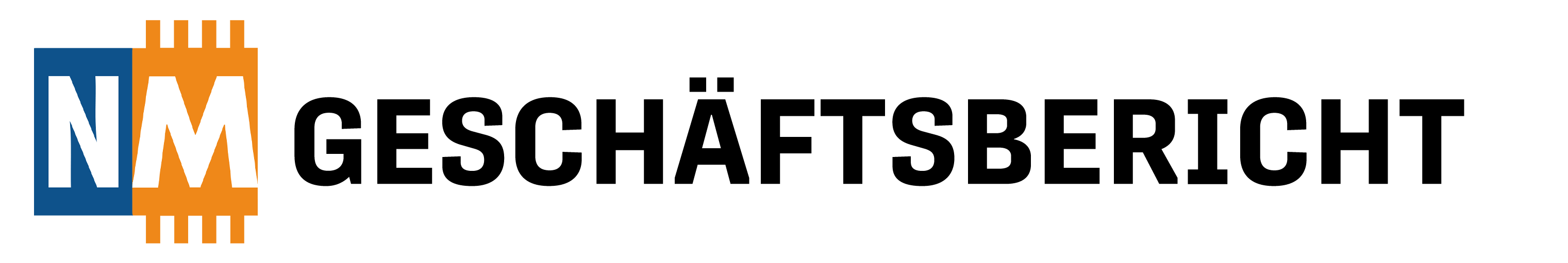Tarifabschluss 2024:
Planungssicherheit in politisch und wirtschaftlich unruhigen Zeiten

Foto: Tim Schaarschmidt
Der Tarifabschluss für die niedersächsische M+E-Industrie ist ein gelungener Kompromiss zwischen den Interessen der Beschäftigten und der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen. Er beinhaltet trotz der Rezession unserer Wirtschaft eine Entgelterhöhung für die Beschäftigten und sorgt in äußerst herausfordernden Zeiten durch seine Laufzeit gleichzeitig für Planungssicherheit in den Betrieben.
Der Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie ist damit ein Musterbeispiel dafür, wie Sozialpartnerschaft auch in schwierigen Zeiten funktionieren kann. Arbeitgeber und Gewerkschaften standen in den Verhandlungen vor scheinbar unlösbaren Herausforderungen: dem berechtigten Interesse der Beschäftigten an einer Entgelterhöhung – und der dramatischen wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen, insbesondere in der Autozulieferindustrie. Das Ergebnis, das nach stundenlangen Verhandlungen, aber unterm Strich zügig erzielt wurde, verdient Respekt. Es zeigt, dass beide Seiten sich ihrer Verantwortung für den Industriestandort Deutschland bewusst sind. Die IG Metall hat ihre ursprüngliche Forderung an die wirtschaftliche Realität angepasst. Und die Arbeitgeber haben ein Paket geschnürt, das zwar bis an die Belastungsgrenze mancher Unternehmen geht, aber gleichzeitig Planungssicherheit schafft und Entlastungsmöglichkeiten für finanziell angeschlagene Betriebe bietet.
Diese Einigung ist jedoch kein Grund zur Entwarnung. Sie wirft vielmehr ein grelles Licht auf die tiefgreifenden Probleme unseres Wirtschaftsstandorts. Es fehlt uns schlicht an Wettbewerbsfähigkeit. Die Industrie leidet unter den politischen Versäumnissen – zu teuren Energiekosten, Bürokratie-Irrsinn oder zu hohen Steuern und Abgaben. Die politische Unsicherheit verschärft die Lage zusätzlich und macht langfristige Planungen für Unternehmen nahezu unmöglich. Was wir jetzt brauchen, ist ein klares Bekenntnis der Politik zur Industrie in Deutschland. Die Belange unseres Standorts und seiner Unternehmen müssen wieder an die Spitze der politischen Agenda rücken. Der Tarifabschluss zeigt, was möglich ist, wenn Verantwortungsbewusstsein und Verhandlungsgeschick zusammentreffen. Doch ohne politische Weichenstellungen wird er nicht mehr sein als ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Gefahr einer Deindustrialisierung ist weiterhin real – und das Zeitfenster, um gegenzusteuern, wird immer kleiner.

Foto: Tim Schaarschmidt

Foto: Tim Schaarschmidt

Foto: Tim Schaarschmidt
Die wichtigsten Punkte des neuen Tarifvertrags
Planungssicherheit
Mit einer Laufzeit von 25 Monaten bietet der Tarifvertrag in unsicheren Zeiten eine stabile Grundlage für Personal- und Finanzplanung.
Noch erträgliche Kostensteigerung
Die Lohnerhöhung von insgesamt 5,1 Prozent verteilt sich über zwei Jahre, was die Belastung für die Unternehmen auf mehrere Zeiträume verteilt. Dies ermöglicht eine kontrollierte Anpassung an steigende Personalkosten. Die durchschnittliche Belastung für die Betriebe beträgt damit (laut Gesamtmetall-Berechnung) 1,09 Prozent (2025) und 2,15 Prozent (2026).
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage
Die automatische Differenzierung wurde beibehalten, allerdings kann statt des tariflichen Zusatzgeldes (T-ZUG B) zukünftig das Transformationsgeld (T-Geld), das ein höheres Volumen hat, differenziert werden. Das verschafft Unternehmen mit einer Nettoumsatzrendite von weniger als 2,3 Prozent mehr Luft zum Atmen, da die Sonderzahlung verschoben und gestrichen werden kann.
Höhere Ausbildungsvergütung
140 Euro mehr für Azubis bereits ab Januar 2025 – das ist ein klares Signal der Wertschätzung für die Auszubildenden und gleichzeitig ein Beitrag zur Zukunftssicherung der M+E-Branche.
Geld oder freie Tage
Die bestehende Regelung der Freistellungstage wird vereinfacht. Beschäftigte mit Kindern bis zwölf Jahren und Pflegende in Teilzeit können künftig häufiger die Option wählen. Bislang waren jeweils zwei mal acht Tage möglich, in Zukunft können weitere drei Jahre mit jeweils sechs Tagen genommen werden. Betriebe können ihrerseits künftig regeln, dass im Fall von Überkapazitäten die Freistellungstage verpflichtend angeordnet werden.

Foto: Tim Schaarschmidt